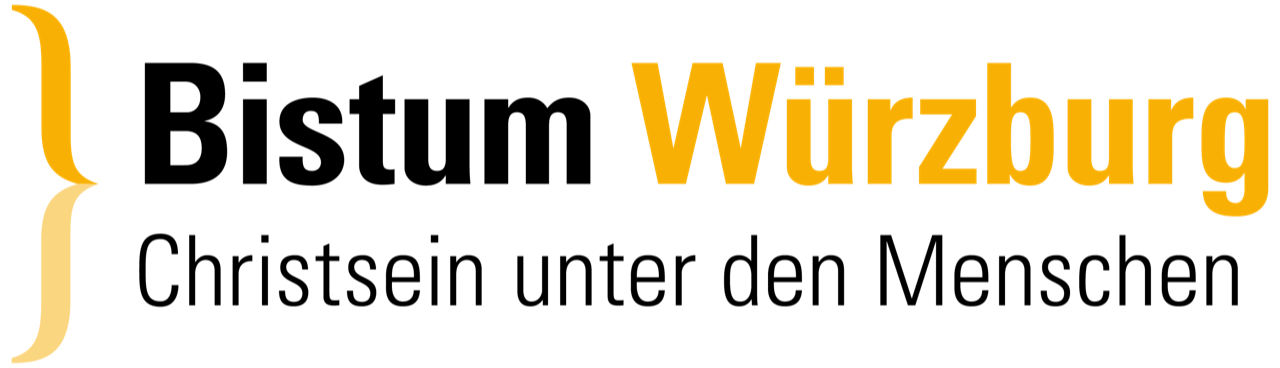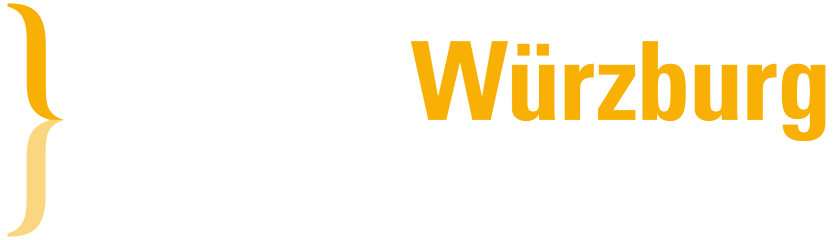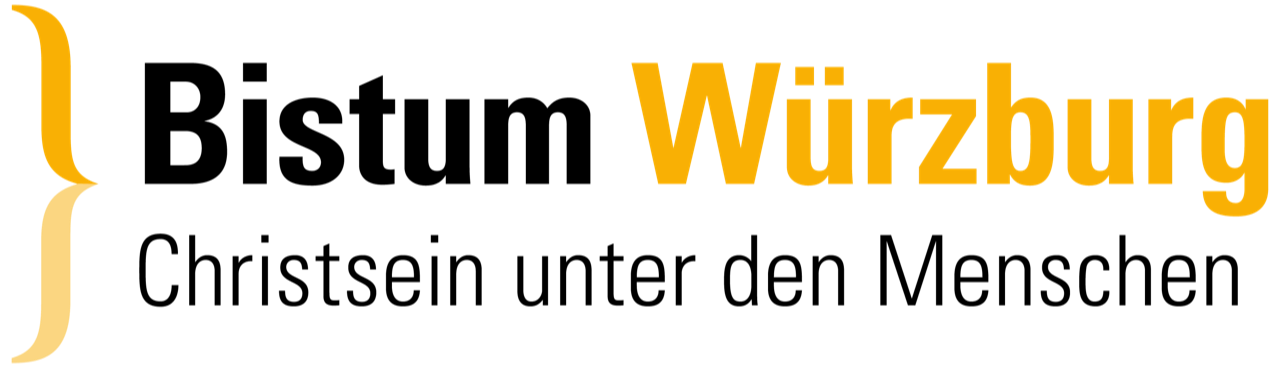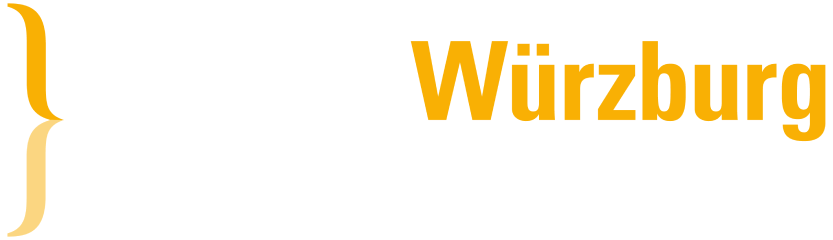Würzburg (POW) Wer auf das Hauptportal im Ehrenhof der Würzburger Residenz zugeht, dem fällt es gleich ins Auge: das Bamberger Bistumswappen mit der Kaiserkrone. Es ist das Wappen des Erbauers der Residenz: Friedrich Karl von Schönborn, Fürstbischof von Würzburg und Bamberg. Wie in seinem Falle hat es in der Neuzeit eine Reihe von Personalunionen dieser Art gegeben. Doch am Beginn der 1000-jährigen Bistumsgeschichte Bambergs, die in diesem Jahr gefeiert wird, standen nicht Eintracht und Verständigung. „Die Art und Weise wie König Heinrich II. die Bistumsgründung Bambergs erreichte, hat damals in Würzburg zu großer Verstimmung geführt“, sagt Erik Soder von Güldenstubbe. Der Würzburger Bistumshistoriker und versierte Kenner des Mittelalters hat an der 2006 erschienenen Festschrift „Das Bistum Bamberg um 1007“ mitgearbeitet. Darin widmet er sich insbesondere der Rolle Würzburgs bei der Bistumsgründung.
„Mutterbistum Bambergs“ nennt Soder von Güldenstubbe Würzburg oft, gehörte doch das Gebiet, „in welchem Heinrich II. ein neues Bistum gründen wollte, bis dahin zum Würzburger Sprengel“. Um die Gründung durchzusetzen, bedurfte es also nicht nur der Zustimmung des Heiligen Vaters in Rom: Der König musste auch den Würzburger Bischof von seinen Plänen überzeugen. Der, auch Heinrich mit Namen, wollte dem König die Zustimmung geben, falls dieser sich für eine Erhebung Würzburgs zum Erzbistum einsetzen würde.
„Als aber im Sommer 1007 die Zusage des Papstes zur Bistumsgründung in Würzburg eintraf, war die erwünschte Erhebung zum Erzbistum in der Urkunde mit keiner Silbe erwähnt. In Bischof Heinrich wuchs der Verdacht, dass der König das Anliegen in Rom gar nicht vorgebracht hatte“, berichtet der Bistumshistoriker. Der Bischof fühlte sich betrogen und verweigerte nun seine Zustimmung. Er nahm auch nicht an der Synode von Frankfurt am Main teil, zu der die weltlichen und geistlichen Fürsten des Reiches geladen waren, um über die Angelegenheit abzustimmen.
Das Bistum Bamberg wurde trotz der Weigerung Würzburgs am Allerheiligentag, also am 1. November des Jahres 1007 bei der Synode in Frankfurt gegründet. Das Würzburger Bistum verlor den Radenzgau und Teile des Volkfeldgaus an Bamberg. Als Ausgleich schenkte König Heinrich II. dem Bistum Würzburg 150 Huben, große Gutshöfe in und um Meiningen. Er stattete es mit Privilegien wie Marktrechten, Wildbann und Grafenrechten aus. „Außerdem ging der Zehnte aus den bis dahin gerodeten und erschlossenen Landstrichen Bambergs an Würzburg.“
Trotz der anfänglichen Verstimmung gibt es heute eine enge Verbindung beider Bistümer – und das nicht nur territorial. „Dass die Würzburger Tradition vielerorts erhalten blieb, sieht man beispielsweise an den Killianskirchen im Bistum Bamberg. Drei davon, Scheßlitz, Staffelstein und Königsfeld, waren bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806 sogar Patronatspfarreien Würzburgs“, weiß Soder von Güldenstubbe. Die Bistumspatrone Bambergs, Heinrich und Kunigunde, finden sich dafür auch in einigen Kirchen des Würzburger Bistums, so zum Beispiel in der Hofkirche der Residenz. Dort kann man am Altar sowohl die Figuren des heiligen Kilian und des heiligen Burkard ausmachen, als auch Heinrich und Kunigunde. „Und unter den Patronen des Bamberger Doms taucht auch der heilige Kilian auf.“
Im 19. und 20. Jahrhundert wurde eine Reihe Würzburger Diözesanpriester Erzbischöfe von Bamberg. „Außerdem haben die Bamberger Weih- und Erzbischöfe auch immer ausgeholfen, wenn ein Würzburger Bischof verhindert war, Vakanzen entstanden sind und umgekehrt“, führt Soder von Güldenstubbe aus. Heute gibt es Verbindungen der Bistümer auf vielen unterschiedlichen Ebenen. „Das Verhältnis ist ein sehr gutes und verbindendes. Es zeichnet sich durch eine stark gewachsene Nähe aus“, betont der Bistumshistoriker. Der Bamberger Erzbischof Dr. Ludwig Schick beispielsweise habe besondere Beziehungen zu Würzburg, da er auch hier Theologie studiert habe.
Bei der Eröffnung des Jubiläumsjahres am 1. November 2006 in Bamberg nahmen Bischof Dr. Friedhelm Hofmann und Weihbischof Helmut Bauer selbstverständlich teil. Generalvikar Dr. Karl Hillenbrand hielt Ende November 2006 eine vierteilige Predigtreihe zum Bistumsjubiläum im Bamberger Dom. „Auch bei Jubiläen alter Würzburger Pfarreien in Bamberg werden die Würzburger Bischöfe oft eingeladen. So zum Beispiel in Altenkunstadt“, berichtet Soder von Güldenstubbe. Die Ordinariate beider Bistümer stünden in regem Austausch und auch durch Ordensleute würden die Diözesangrenzen immer wieder überschritten.
Aktuell steht die Frage an, ob die Bamberger Priesteramtskandidaten und Theologiestudenten nach der Umwandlung der Bamberger Theologischen Fakultät zu einem Institut für die Religionslehrerausbildung künftig in Würzburg ihr Diplomstudium absolvieren werden. Bemühungen um eine einvernehmliche Lösung sind im Gange. Bis Ende Februar will sich das Erzbistum Bamberg entscheiden.
Wer mehr über die gemeinsame Geschichte der Bistümer Bamberg und Würzburg erfahren möchte, dem empfiehlt Erik Soder von Güldenstubbe die Festschrift „Das Bistum Bamberg um 1007“.
Josef Urban (Hg.): Das Bistum Bamberg um 1007. Festgabe zum Millennium, Bamberg 2006. 432 Seiten. 44,80 Euro. Buchverlag des Archivs des Erzbistum Bamberg 2006.
(0407/0136; E-Mail voraus)
Hinweis für Redaktionen: Fotos abrufbar im Internet