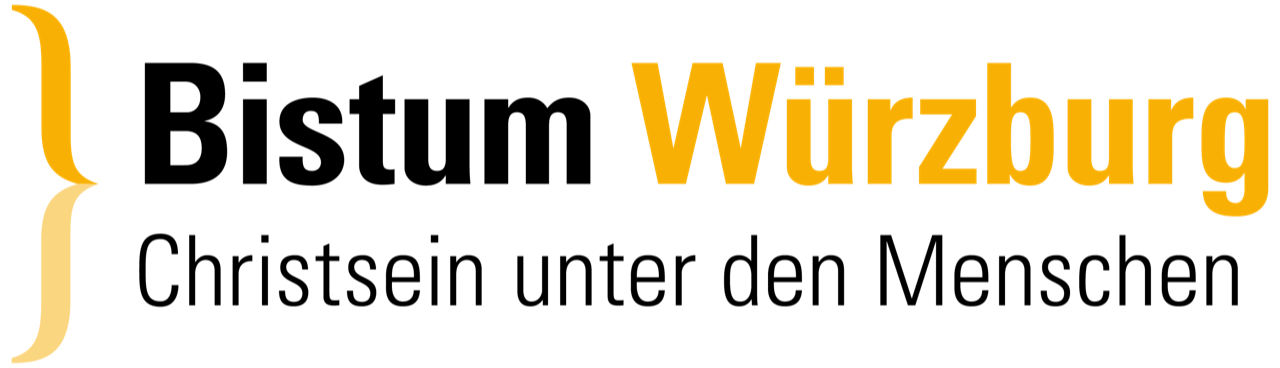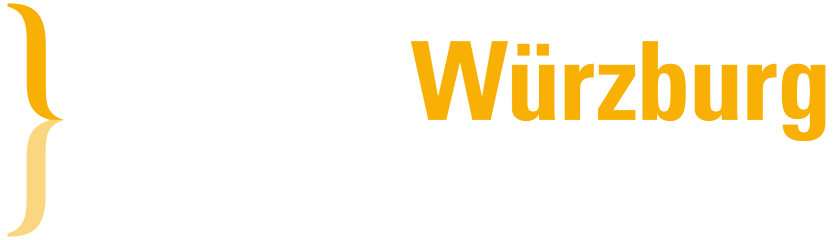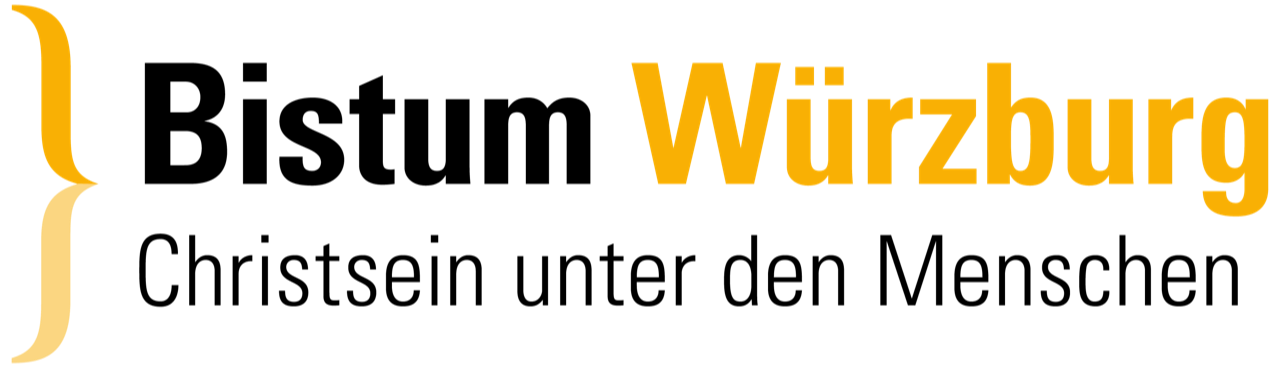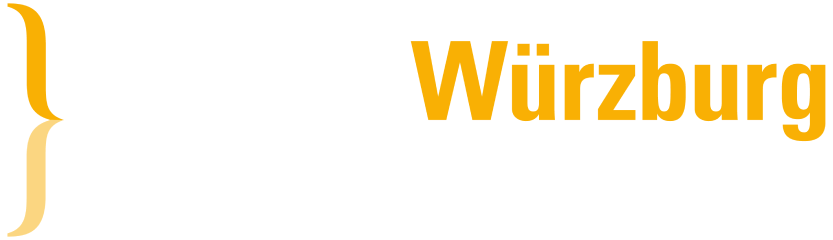Als vor wenigen Monaten das Kammerspiel „Gott“ (Ferdinand von Schirach) im Fernsehen lief, und Zuschauerinnen und Zuschauer zur Abstimmung über Ja oder Nein zum assistierten Suizid aufgefordert wurden, sorgte das für Aufsehen und kontroverse Diskussionen, nicht nur in der anschließenden Sendung „Hart, aber fair“. Mehr als 70 Prozent sprachen sich für die Suizidhilfe aus.
Am 18. März trafen sich im Schönstattheim am Würzburger Hubland die Ethikbeauftragten aus der stationären Altenhilfe, um ebenfalls über die Fragen von Suizidhilfe, Sterbebegleitung und das sogenannte Sterbefasten nachzudenken. Der Unterschied zum Kammerspiel: „Wir müssen entscheiden und sind an weitreichenden Entscheidungen beteiligt“, brachte es eine Pflegedienstleistung (PDL) auf den Punkt.
Franziska Brod, gelernte Krankenschwester und studierte Pflege- und Gesundheitsmanagerin (FH), Referentin für Hospiz, Palliativ und Generalistik im Fachbereich Gesundheit und Alter des Diözesan-Caritasverbandes, führte gemeinsam mit Altenheimseelsorger Wolfgang Zecher durch den Tag. Vortrag, Impuls, Diskussion und kollegialer Austausch sorgten für methodische Abwechslung und rege Beteiligung. Corona, das wurde immer wieder deutlich, habe in der Altenhilfe wie ein Brennglas gewirkt; alte Probleme hätten sich verdichtet, viele neue seien hinzugekommen. Das Leid bei vielen Bewohnerinnen und Bewohnern und das tägliche Mitleiden der Pflegekräfte sei für Außenstehende kaum vorstellbar.
Der assistierte Suizid
Der assistierte Suizid dürfe nicht zum neuen Standard in der Altenhilfe werden, waren sich die Ethikberaterinnen einig. Vielmehr gelte es, die Palliativ- und Hospizversorgung auszubauen und zu stärken. „Die Menschen, die in unsere Einrichtungen kommen, sind immer älter und immer gebrechlicher“, sagte eine Wohnbereichsleiterin und wies darauf hin, dass die Verweildauer der Menschen oft nur noch Wochen oder wenige Monate betrage. Zuvor hatte Franziska Brod zum Thema Suizid und Suizidhilfe referiert und mit einem Film zur Sterbehilfe in der Schweiz zur Diskussion angeregt. „Der § 217 StGB wurde gekippt. Wir müssen uns auf Diskussionen und neue Wirklichkeiten einstellen“, so Brod. „Was befürchten Sie für sich und die Kolleginnen in der Einrichtung, wenn der assistierte Suizid Einzug hielte?“
Deutlich wurde, dass die ganz persönliche Beurteilung der Suizidhilfe eng verknüpft ist mit religiösen und kulturellen Hintergründen. Wolfgang Zecher erläuterte anschaulich die unterschiedlichen Begriffe – aktive, passive, direkte und indirekte Sterbehilfe – und die Rechtslage hierzulande und in den europäischen Nachbarstaaten. Vorrang müsse die Prävention haben, so Zecher.
Das sogenannte Sterbefasten
Es komme immer wieder vor, dass Bewohnerinnen und Bewohner, bewusst auf Nahrung und Flüssigkeit verzichteten, um ihr Leben vorzeitig zu beenden, berichteten die Ethikbeauftragten. Letztlich müsse eine solche Entscheidung, wenn sie freiverantwortlich getroffen wurde, toleriert werden. Zecher wies darauf hin, dass auch diesen Menschen die notwendige Pflege geschuldet sei. Sie stelle keine Mitwirkung dar. „Ist der Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit ein Suizid?“, fragte Zecher und wie weit reiche die Autonomie des Einzelnen?
„Angehörige und Zugehörige können manche Entscheidungen nicht nachvollziehen und mittragen. Sie werfen uns vor, wir würden die Leute einfach verhungern lassen.“ Es brauche mehr Aufklärung bei den Menschen und die klare Ansage, dass es um den Willen des Patienten gehen müsse und nicht um eigene Interessen.
„Wir brauchen Richtlinien“
So wichtig die Information und die Diskussion auch sei, es brauche dringend Richtlinien für die stationäre Altenhilfe. Lässt sich verhindern, dass Sterbehelfer in die Pflegeeinrichtungen kommen? Wie sollen wir umgehen mit Bitten um assistierten Suizid? Das Konzept Advance Care Planning (ACP) nach § 132g SGB V müsse endlich umgesetzt werden, um Menschen in der letzten Lebensphase gut beraten und begleiten zu können.
„Ich bin sehr dankbar, dass dieser erste Ethik-Tag als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte“, war immer wieder zu hören. Diskussionen und kollegialer Austausch seien per Video niemals so lebendig und direkt möglich. Die hohe Impfquote unter den Teilnehmerinnen und ein gutes Hygienekonzept machten die gemeinsamen Stunden möglich. Viel Lob erhielten neben Franziska Brod und Wolfgang Zecher auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schönstattheim. „Wir freuen uns auf den nächsten Ethik-Tag, der erneut auf der Marienhöhe stattfinden wird“, dankte Wolfgang Zecher Sr. Maria Annetraud und dem Team um Elmar Kreißl in der Küche.
Sebastian Schoknecht