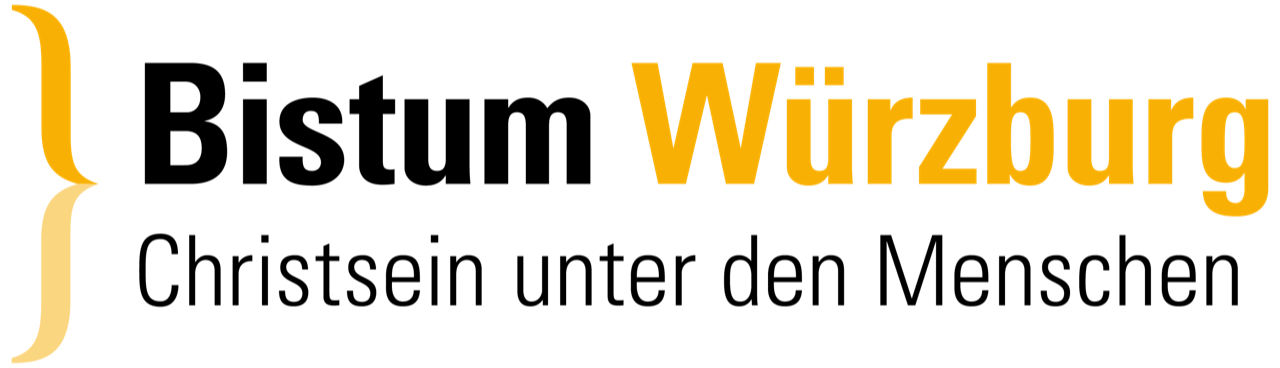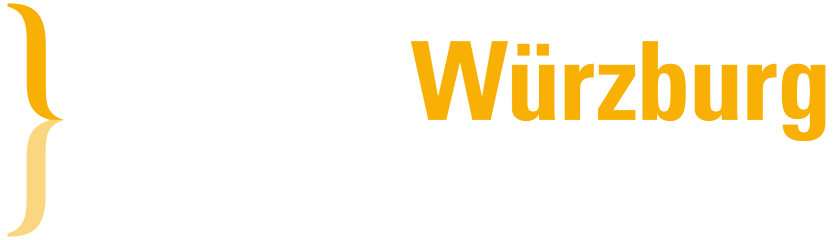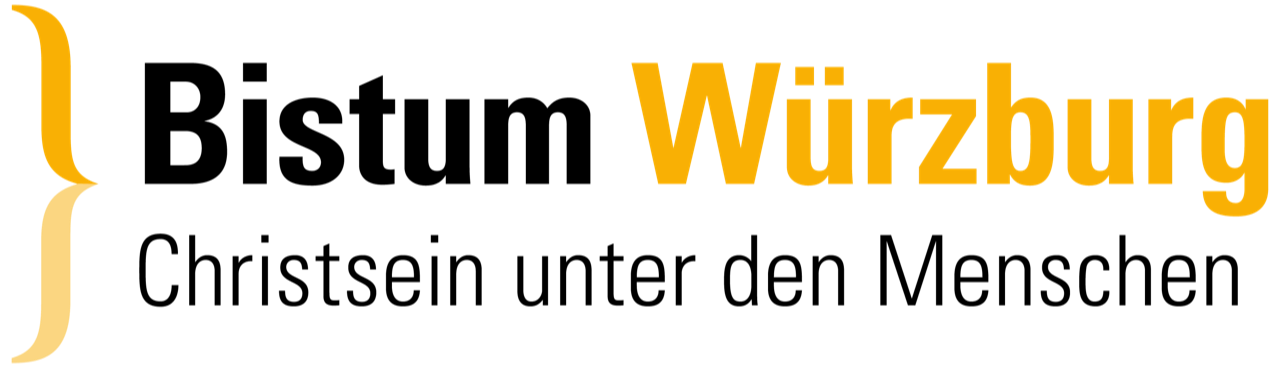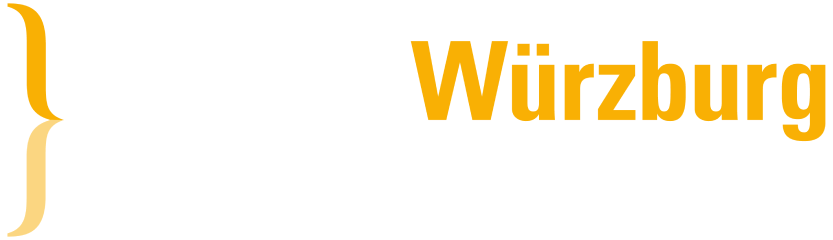Tückelhausen (POW) Wie viel Platz braucht ein Mensch, um menschlich leben und arbeiten zu können? Gerade so viel Platz, dass ein Bett und ein Tisch in den Raum hineinpassen? Oder doch deutlich mehr, am besten mit Garten und mehreren Etagen? Antworten auf diese Fragen aus der Zeit zwischen dem zwölften und dem 20. Jahrhundert gibt die Ausstellung „Von der Kartäuserzelle zur modernen Minimalwohnung“, die derzeit im Kartäusermuseum Tückelhausen zu sehen ist. Geschaffen wurde sie von Architekturstudenten der Technischen Universität München.
„90 Prozent des Schaffens von Architekten hat mit dem Bauen von Wohnraum zu tun. Da lag die Beschäftigung mit historischem Lebensraum nahe, um zu sehen, welche kartäusischen Elemente auch heute noch prägend sind“, erklärt Diplomingenieurin Elke Nagel. Die Dozentin am Lehrstuhl für Baugeschichte, Historische Bauforschung und Denkmalpflege von Professor Dr.-Ingenieur Manfred Schuller besuchte zu diesem Zweck mit einem Seminar von Studenten ausgewählte Kartausen in Deutschland, der Schweiz, Italien und Frankreich. Dort warfen sie einen Blick auf Raumgrößen, innere Aufteilung und Aspekte der Wohnqualität. Nagel selbst hat für die Doktorarbeit, an der sie momentan schreibt, 96 historische oder noch genutzte Kartausen besucht. „Auch wenn die Kartäusermönche ein Leben in Stille führen, weiß ich aus Briefwechseln mit Prioren, wie ausgeglichen und in sich ruhend die Mönche sind, die in diesen Zellen von Eintritt in das Kloster bis zum Tod wohnen.“ Für Außenstehende sei das mitunter nur schwer nachzuvollziehen, da außer zum wöchentlichen Spaziergang und zum täglichen Gottesdienstbesuch kein Kartäuser seine Zelle verlässt.
In einzigartiger Weise drücke die Kartausen-Architektur die Prinzipien und Ordensideale aus, sagt Nagel: Die Kartäuser-Mönche leben in ihren Zellenhäuschen mit Garten, die sich alle an den Kreuzgang zur Klosterkirche anschließen. „Die Ordensmänner sind, so paradox das klingt, eine Gemeinschaft von Eremiten.“ Weitere vermeintliche Widersprüche fänden sich in der Tatsache, dass das Wohnen in der Zelle zwar die freiwillige Beschränkung auf das Notwendigste bedeute. Zugleich erwachse dem Mönch daraus aber auch die Freiheit seines ganz persönlichen und ungestörten Lebensraums. Neben einem Schlafraum gibt es meist einen Gebetsraum und ein Werkzimmer. Eine eigene Heizung und eine Wohnfläche von meist mehr als 100 Quadratmetern auf mindestens zwei Stockwerken sind Elemente, die im Mittelalter alles andere als selbstverständlich waren. „Man muss dazu wissen, dass auch damals nur Studierte dem Orden beitreten konnten. Im Mittelalter wurden daher meist Adelige oder Mitglieder wohlhabender Familien Kartäuser. Für diese Menschen war trotz der vermeintlichen Größe des Wohnraums die Beschränkung auf das Wesentliche deutlich zu spüren.“ Das gelte auch für den Garten.
„Viele Mönche pflanzen dort einen Baum, damit sie in ihrer Abgeschiedenheit einen Blick dafür haben, wie sich die Natur im Lauf der Jahreszeiten verändert, und sie an seinem Wachstum auch einen Vergleich haben, wie sie altern und wachsen.“ Außerdem sei die persönliche Grünanlage, die stets von hohen Mauern umgeben ist, wichtig, damit die Augen des Mönchs Entspannung finden. Erst bei einer Blickweite jenseits von sieben Metern sei der Sehapparat nicht mehr angestrengt, erläutert die Architektur-Expertin. „Ich finde es vorbildlich, wie sehr bei den Planungen der Kartäuserzellen immer der Mensch im Mittelpunkt stand.“
Wenig verwunderlich erscheint es Nagel daher auch, dass der berühmte Architekt Le Corbusier sich von den kartäusischen Ideen hat inspirieren lassen. Seine „Unité d’Habitiation de Marseille“, ein Wohnblock mit mehr als 330 Einheiten aus der Zeit zwischen 1947 und 1952, erschließt wie der Kreuzgang in einer Kartause durch einen innenliegenden Gang die jeweils zweigeschossigen Wohnungen von 98 Quadratmetern Grundfläche. Und wie in der Kartause gibt es auch in diesem Gang Durchreichen zu den einzelnen Wohneinheiten, die aber – anders als beim Vorbild – nicht der Nahrungsversorgung durch die Klosterküche dienen.
Die Teilnehmer von Nagels Seminar haben alle Gebäude im Maßstab 1:50 als Modell gebaut. Mehr als klein wirkt, selbst neben der bescheidensten Kartäuserzelle, der von Werner Wirsing und Günter Eckert für die Olympischen Spiele von 1972 in München entworfene Wohnkubus des sogenannten Frauendorfs. Inklusive Dachterrasse vereint er auf einer Wohnfläche von 27 Quadratmetern Nasszelle, Küche und Aufenthaltsraum im Untergeschoss sowie Schlaf und Arbeitsraum im Obergeschoss. „Man muss sich aber vor Augen halten, dass dieses Gebäude nicht als Lebensraum auf Lebenszeit konzipiert ist“, betont die Diplom-Ingenieurin.
Die Ausstellung im Kartäusermuseum Tückelhausen ist bis Sonntag, 26. Juli, freitags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Nähere Informationen bei: Museen der Diözese Würzburg, Telefon 0931/38665600, E-Mail museen@bistum-wuerzburg.de, Internet www.museen.bistum-wuerzburg.de.
(2309/0670; E-Mail voraus)
Hinweis für Redaktionen: Fotos abrufbar im Internet